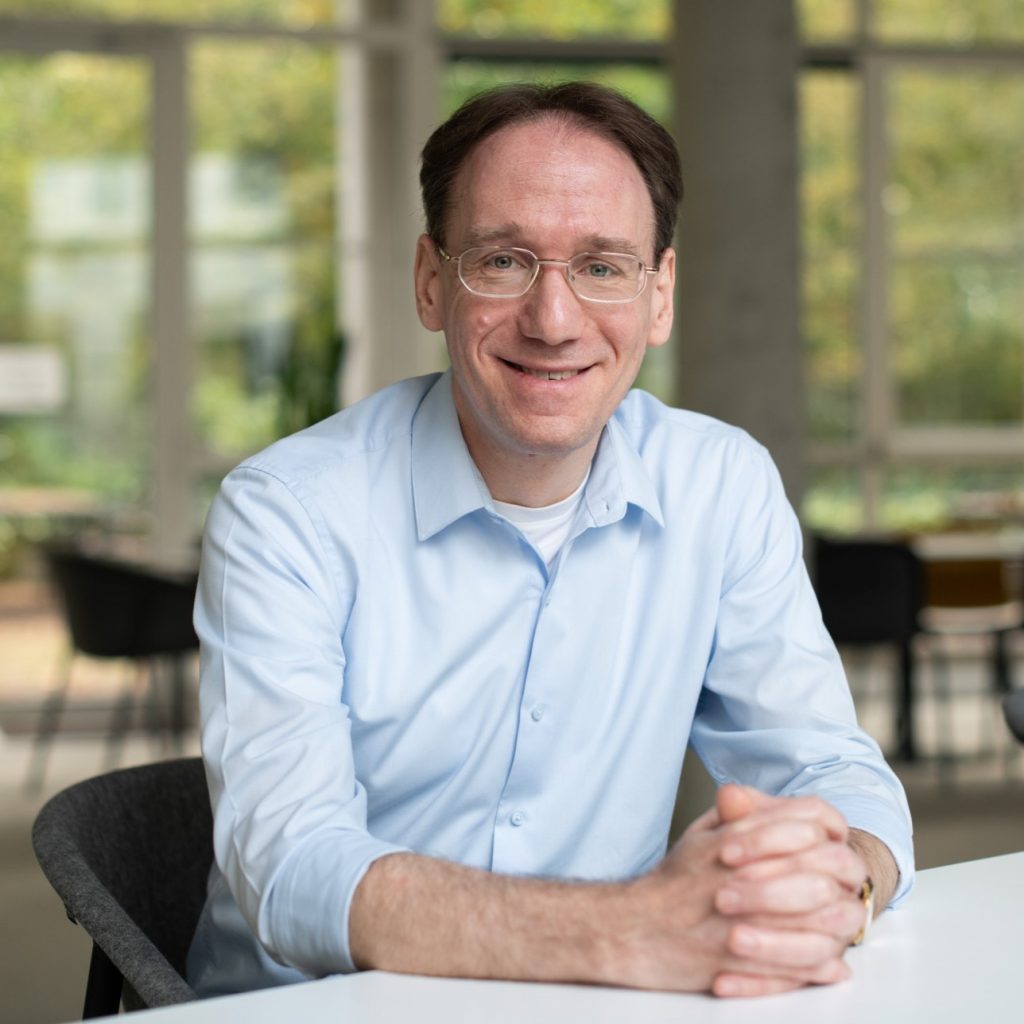„Deine Wissenschaft wird sich um dich kümmern“
In der Wissenschaft hat sich im Laufe der Jahre viel verändert, aber um ein erfolgreicher Wissenschaftler zu werden, braucht es nach wie vor Ausdauer und ein bisschen Glück. Simon Fisher erzählt uns anhand seiner Erfahrungen, wie man dieses Ziel erreichen kann, wenn man sich der Wissenschaft verschreibt und seine Nische findet.
Welche Postdoc-Stellen hatten Sie inne?
„Ich hatte zwei Postdoc-Stellen, eine sehr kurze und eine längere. Einer meiner Doktorväter war Tony Monaco, der am Wellcome Trust Centre for Human Genetics Krankheitsgene kartierte. Er bot mir im Januar, kurz nach Abschluss meiner Promotion, eine Stelle an, aber die Finanzierung begann erst im Oktober. So machte ich zunächst acht Monate lang einen Postdoc bei Adrian Hill, wo ich mich mit der genetischen Anfälligkeit für Lepra befasste, um die neuesten Techniken der Genkartierung zu erlernen. Anschließend absolvierte ich den Postdoc bei Tony zum Thema Sprach-, Sprech- und Lesegenetik, was mich wirklich interessierte. Ich blieb dann etwa sechs Jahre lang bei Tony.“
Was waren einige Ihrer Überlegungen bei der Wahl Ihres Arbeitgebers? Können Sie sich noch an Ihren Gedankengang erinnern?
„Zunächst einmal suchte ich nach einem wissenschaftlichen Gebiet, das mich interessierte, aber danach war einer der Gründe, warum ich unbedingt für Tony arbeiten wollte, dass er als großartiger Mentor bekannt war – also das waren die Dinge, die mir durch den Kopf gingen.
Die erste Postdoc-Stelle war allerdings eher opportunistisch, da ich wusste, dass das Wellcome Trust Centre und Adrians Labor ein großartiger Ort waren, um neue genetische Techniken zu erlernen. Als ich dann zu Tonys Labor wechselte, war ich mit all diesen Kenntnissen bereit loszulegen.“
Wie weit sind Sie für Ihren Postdoc umgezogen?
„Nicht sehr weit. Meinen PhD machte ich in einem Labor im Zentrum von Oxford, und meine Postdoc-Stellen waren in Headington, nur 10 Minuten mit dem Fahrrad von meinem früheren Wohnort entfernt.“
Oh wow, Sie mussten also nicht umziehen oder so?
„Nun, während meinem PhD bin ich von Zimmer zu Zimmer gezogen und habe an ungefähr acht verschiedenen Orten gewohnt. Als ich dann die Postdoc-Stelle bekam, dachte ich: „Jetzt möchte ich mich niederlassen.“ Also haben wir ein Haus gekauft, das nicht weit vom Wellcome Trust Centre entfernt war, und das hat gut funktioniert.“
Welche Erfahrungen haben den Postdoc zu einem wertvollen Schritt nach dem PhD gemacht?
„Ein Teil war, dass ich eine gute Balance fand, in der ich nicht bei Null anfangen musste, sondern das Projekt auch selbst steuern konnte. Wir erhielten DNA-Proben für unsere Analysen, und ich arbeitete am Labortisch an den Genkartierungstechniken, aber ich begann auch mich mehr mit strategischen Fragen zu befassen.
Und ich lernte, dass ich es mochte, mit den Psychologen darüber zu sprechen, was sie untersuchen und wie wir das mit der Genetik verknüpfen können. Ich stellte fest, dass ich ziemlich gut darin war, zwischen den Fachgebieten zu vermitteln, und es machte mir Spaß. Und es half uns, bessere wissenschaftliche Arbeit zu leisten, indem wir versuchten, die Grenzen der jeweiligen Fachgebiete zu verstehen. Ich habe durch die Gespräche mit den Mitarbeitern der Partnerlabore viel gelernt.“
Welche weiteren Fähigkeiten haben Sie als Postdoc erworben, von denen Sie später profitiert haben?
„Tony hatte ein besonders gut funktionierendes Labor, in dem alle respektvoll miteinander umgingen und interagierten – jeder wusste, was seine Aufgabe war, und fühlte sich nicht von anderen bedroht. Das hat mir geholfen zu verstehen, wie man ein gutes Labor führt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich, wenn ich mich einfach so verhalten würde, auch ein Umfeld schaffen könnte, in dem sich alle wohlfühlen, gut unterstützt werden und mit anderen zusammenarbeiten. Das habe ich durch die Beobachtung von Tony gelernt.“
Vor welchen Herausforderungen standen Sie während Ihrer Postdoc-Zeit und wie sind Sie damit umgegangen?
„Nun, Ablehnungen von Artikeln und Förderanträgen sind hart. Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn meines PhDs die naive Vorstellung hatte, man schreibe einfach einen Artikel, schicke ihn an die Zeitschrift und dann werde er veröffentlicht.
Ich erinnere mich, dass wir während meines PhDs dieses Gen identifiziert haben, das eine vererbte Nierensteinerkrankung verursacht, und es gab eine Zeitschrift, die gerade erst gegründet worden war: Nature Genetics. Und wenn man ein Krankheitsgen findet – damals waren nur etwa 10 oder 12 bekannt –, reichte man den Artikel bei dieser Zeitschrift ein. Ich war total begeistert, weil wir diese Entdeckung gemacht hatten, und ich war es, der sie gemacht hatte. Also schrieb ich meinen Artikel und schickte ihn an Nature Genetics, und pfft, sie hatten überhaupt kein Interesse. Das war eine kleine Lektion, aber es war gut, das früh zu lernen – dass man gegenüber solchen Dingen robust sein muss.
Gegen Ende meiner Postdoc-Zeit stellte sich eine weitere Herausforderung: mich von meinem Betreuer abzugrenzen. Denn nach sechs Jahren bei Tony gründete ich meine eigene, separat finanzierte Gruppe im Wellcome Trust Centre, aber es dauerte noch einige Jahre, bis die Leute mich als unabhängig anerkannten, obwohl ich ziemlich viele Arbeiten ohne meinen Mentor veröffentlichte.
Das sehe ich auch bei einigen Leuten, die mit mir zusammengearbeitet haben und dann andere Forschungsprojekte verfolgt haben. Die Leute haben diese neuen Arbeiten mit mir in Verbindung gebracht, und ich muss sagen: „Das ist ihre Sache, und sie sollten dafür die Anerkennung bekommen!“ Deshalb versuche ich, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene Nische zu finden.“
Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Betreuer als Postdoc?
„Meinen ersten Vorgesetzten habe ich nicht oft gesehen, aber ich wusste, was ich zu tun hatte, und es gab andere Leute, die für meine Betreuung und Ausbildung zuständig waren.
Mit meinem langjährigen Vorgesetzten lief es gut, weil er mir sehr vertraute, mich aber gleichzeitig nicht im Stich ließ. Wir trafen uns etwa einmal pro Woche, und er war immer über die Details der Experimente informiert oder fand schnell eine Lösung, wenn es Probleme gab.
Was ich an der Wissenschaft außerdem sehr schätze, ist, dass man seinen Leidenschaften nachgehen kann. Ich finde, das ist etwas Besonderes – die richtige Balance zu finden, damit die Leute forschen können und ermutigt werden, ihre Nische zu finden. Ich glaube, das ist etwas, was mein Postdoc-Betreuer wirklich gut konnte und was ich auch in meinem Labor versucht habe, denn genau dafür machen wir Wissenschaft – um diesen interessanten Richtungen nachzugehen.“
Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Rolle eines Postdocs im Laufe der Jahre verändert?
„Die Lage ist schwieriger geworden. Ich habe das Gefühl, dass es viele wirklich erstaunliche Menschen gibt, die eine großartige Karriere machen sollten. Und dann sehe ich, dass es tatsächlich nicht ausreicht, ein kluger, fleißiger und hervorragender Mensch zu sein. Heutzutage braucht man viel Ausdauer und auch Glück. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass es irgendwie ein Versagen ist, nach der Postdoc-Zeit etwas anderes zu machen, denn Menschen können das, was sie in einer wissenschaftlichen Karriere gelernt haben, in allen möglichen Bereichen anwenden. Wir müssen die Menschen dabei unterstützen, denn die Wissenschaft ist nicht der einzige Ort, an dem man hervorragende Leistungen erbringen kann.
Eine weitere Veränderung ist, dass die Spezialisierung viel komplexer geworden ist. Man muss in der Lage sein, diese hochspezialisierten neuen Techniken anzuwenden – und über das nötige Hintergrundwissen verfügen, um dies überhaupt tun zu können –, aber gleichzeitig möchten wir, dass die Menschen über Fachgrenzen hinweg miteinander kommunizieren. Man muss heute nicht nur wissenschaftlich arbeiten, sondern auch hervorragende Präsentationen halten, mit der Öffentlichkeit kommunizieren und erklären, warum die eigene Wissenschaft so interessant ist und technische Anwendungen hat. Deshalb habe ich das Gefühl, dass wir heute viel mehr von unseren Postdocs verlangen, als damals von mir verlangt wurde.“
Welchen Rat würden Sie Ihrem früheren Postdoc-Ich geben?
„Ich denke, man muss Spaß haben, an dem, was man tut. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, um auf die Wissenschaft fokussiert zu bleiben. Und noch etwas: Finde deine Nische. Ich bin wirklich froh, dass ich meine gefunden habe, aber das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Finde das, was du tun willst und was dir Spaß macht, und dann gib dein Bestes.
Ich würde meinem früheren Ich auch sagen: „Verliere nicht den Mut.“ Das sage ich auch heute Leuten, wenn sie eine Ablehnung erhalten, denn wir alle erleben Momente, in denen wir irgendwie demoralisiert sind – wenn Förderanträge oder Artikel abgelehnt werden –, und in solchen Momenten ist es wichtig, sich auf die Wissenschaft zu konzentrieren, die man gerne macht, und nicht den Mut zu verlieren.
Und dann gibt es noch ein Zitat, etwas, das Eric Kandel einmal zu mir gesagt hat, an das ich mich aber oft zu erinnern versuche: Er sagte: „Kümmere dich um deine Wissenschaft, und deine Wissenschaft wird sich um dich kümmern.“
Simon Fishers Arbeit hat unser Verständnis der Rolle der Genetik in der Sprache und ihrer Evolution revolutioniert.
| Karrierestufen | Rollen |
| PhD (1991-1996) | Doktorand an der Universität Oxford |
| Postdoc (1996-2002) | Postdoktorale Forschung unter Adrian Hill (Februar–September 1996) und Anthony Monaco (Oktober 1996–2002) am Wellcome Trust Centre for Human Genetics (WTCHG)
|
| Unabhängiger Gruppenleiter (2002-2010) | Forschungsstipendium der Royal Society, Leiter der Gruppe für Molekulare Neurowissenschaften am WTCHG
|
| Direktor (2010-Gegenwart) | Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik |
| Professor (2012-Gegenwart) | Professor für Sprache und Genetik an der Radboud-Universität |
Übersetzung English – Deutsch: Carmen Ramoser